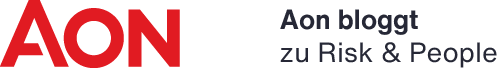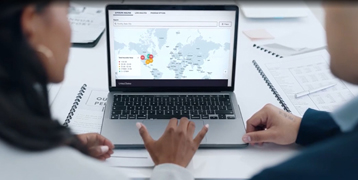Hier schreiben regelmäßig Aon Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen in den Themenfeldern Risk Capital und Human Capital. Mit diesen Informationen und Erkenntnissen können Führungskräfte bessere Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen.

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie: Was Unternehmen bis 2026 wissen und umsetzen müssen
Mehr als die Offenlegung der Gehaltsstruktur
Mit der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die im Juni 2026 in Kraft tritt, verfolgt die Europäische Union ein klares Ziel: mehr Transparenz bei der Vergütung, den Abbau geschlechtsspezifischer Entgeltunterschiede und die Gewährleistung von gleicher Bezahlung für gleichwertige Arbeit. Die Richtlinie betrifft sämtliche EU-Mitgliedstaaten und umfasst alle Mitarbeitenden – von Voll- und Teilzeit- bis hin zu Zeitarbeitskräften. Sie bezieht sich nicht nur auf Gehälter, sondern auch auf variable Bestandteile und ergänzende Leistungen wie Benefits.
Wer muss wann berichten?
Die Berichtspflichten sind gestaffelt nach Unternehmensgröße. Ab Juni 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden jährlich ihren Gender Pay Gap offenlegen. Unternehmen mit 150 bis 249 Beschäftigten sind ebenfalls ab 2027 berichtspflichtig, allerdings nur alle drei Jahre. Betriebe mit 100 bis 149 Mitarbeitenden folgen ab Juni 2031 und berichten danach ebenfalls alle drei Jahre. Kleinere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten können freiwillig teilnehmen. Damit schafft die Richtlinie erstmals einen EU-weiten Standard, der Schritt für Schritt in den kommenden Jahren zur Anwendung kommt. Verglichen mit dem in Deutschland bereits bestehendem Entgelttransparenzgesetz (Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen vom 30. Juni 2017) sind dabei deutlich schärfere und weitergehendere Regelungen zu erwarten, wie zuerst in den Schwellenwerten der Berichtspflicht selbst. Auch weitergehende und zeitlich unbeschränkte Auskunftsrechte von Beschäftigten und Bewerbenden sowie die Umkehr der Beweislast, stärkere Sanktionen und auch vermehrte Schadensersatzmöglichkeiten sind wesentliche Kriterien.
Herausforderungen bei Benefits und Zusatzleistungen
Besonders herausfordernd wird für viele Arbeitgeber die Integration von Benefits in die Transparenzberichte. Denn Altersvorsorge, Gesundheitsleistungen, Freizeitangebote oder Mobilitätsprogramme als Teil der Gesamtvergütung müssen künftig in die Entgeltgleichheitsanalyse einbezogen werden. Hierbei stoßen Unternehmen schnell an Grenzen: Vielfältige und diverse Regelungen, individuelle Sonderabsprachen oder Ermessensentscheidungen erschweren vielfach die Bewertung. Hinzu kommt, dass die tatsächlichen Kosten von Leistungen nicht immer dem realen Wert entsprechen und die Vergleichbarkeit erschweren. Vorrangig ist aber das Zusammentragen relevanter Daten, die häufig in verschiedenen Systemen vorgehalten werden. Und auch wenn Unterschiede technisch akzeptiert sind, kann die Offenlegung zu Unmut in der Belegschaft führen. Eine transparente und adäquate Kommunikationsstrategie sollte bereits im Vorfeld angedacht werden, ebenso wie der Umgang mit vermehrten Anfragen der Mitarbeitenden: Die relevanten Informationen sollten Unternehmen auch effizient bereitstellen können.
Sichtbarer werden auch indirekte Ungleichheiten
Die Richtlinie lenkt den Blick aber nicht nur auf geschlechtsspezifische Unterschiede, sondern auch auf andere Dimensionen von Ungleichheit. Benefits, die üblicherweise geschlechterneutral zur Verfügung stehen, können geschlechterspezifische Verzerrungen mit sich bringen. Im Beispiel der betrieblichen Altersvorsorge nutzen Mitarbeitende mit geringerem Einkommen Angebote zu Matching oder Entgeltumwandlungssystemen unter Umständen weniger stark – ein Aspekt, von dem Frauen durch Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitarbeit stärker betroffen sind. Auch bei Gesundheits- und Risikoleistungen wie Lebensversicherungen und Angeboten zur mentalen Gesundheit ergeben sich teils deutliche Unterschiede. Es gilt zu entscheiden, wie man berichtsneutrale Unterschiede in der Gestaltung von Benefits werten möchte. Man kann dies als Chance verstehen, solche indirekten Ungleichheiten im Sinne der eigenen Philosophie nachzuarbeiten
Drei Wege zur Entgelttransparenz
Unternehmen können unterschiedlich mit der neuen Richtlinie umgehen. Ein rein reaktiver Ansatz beschränkt sich darauf, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und die erforderlichen Berichte vorzulegen. Ein proaktiver Ansatz geht einen Schritt weiter, indem er bestehende Ungleichheiten aktiv analysiert und Maßnahmen ergreift, um diese zu beseitigen und künftige Ungleichheiten zu vermeiden. Am weitesten reicht ein strategischer Ansatz: Hier entwickeln Unternehmen eine umfassende Entgeltstrategie, ja vielmehr eine Total-Rewards-Strategie, die Fairness und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt und neben Gehalt auch Faktoren wie Betriebszugehörigkeit, Leistung und Sozialleistungen einbezieht.
Vorbereitung ist entscheidend
Um den Anforderungen gerecht zu werden, sollten Unternehmen ihre Vergütungs- und Vorsorgepläne frühzeitig überprüfen, potenzielle Ungleichheiten identifizieren und klare Maßnahmenpläne entwickeln. Eine offene und transparente Kommunikation mit Mitarbeitenden sowie weiteren Stakeholdern ist dabei ebenso wichtig wie die technische Aufbereitung der relevanten Daten. Wer die Zeit bis 2026 nutzt, um seine Prozesse zu überprüfen, bei Bedarf neu aufzustellen und strategische Ziele klar zu definieren, kann die Richtlinie nicht nur als regulatorische Pflicht, sondern auch als Chance begreifen: als Möglichkeit, Vertrauen zu stärken, Fairness sichtbar zu machen und die eigene Arbeitgebermarke zu stärken.